Der Landesausschuss der Studentinnen und Studenten, die Landesfachgruppe Hochschule und Forschung der GEW Brandenburg und die Brandenburgische Studierendenvertretung haben vier der im Landtag vertretenen Parteien Fragen zur Hochschulpolitik gestellt. Hier folgt eine Zusammenfassung der Antworten;
Übersicht
↓ Hochschulentwicklungsplanung
↓ Qualität von Studium und Lehre
↓ Studentische Beschäftigte und Lehrbeauftragte
↓ Investitionsbedarf in Infrastruktur
↓ Gebühren für Studierende
↓ Klagerecht für Gleichstellungsbeauftragten
↓ Parlamentarische Initiativen
1. Hochschulentwicklungsplanung

Die Hochschulentwicklungsplanung der Landesregierung vom März 2013 ist bis das Jahr 2025 ausgelegt. Sechs Jahre nach Inkrafttreten des Planes hat sich die Situation in Brandenburg sowohl in der Gesellschaft als auch an den Hochschulen teilweise beträchtlich verändert.
Welche Bilanz ziehen Sie im Jahre 2019? Wo hat die Entwicklung die Planung überholt? Wo sehen Sie die Notwendigkeit der Aktualisierung des Plans?
Welche Zukunftsaufgaben, insbesondere in Hinblick auf die regionale Entwicklung und den Bedarf an ausgebildeten akademischen Fachkräften, würden Sie ins Zentrum der Planung bis 2025 rücken?
Antwort der CDU
Die CDU will „insbesondere die Hochschulen für angewandte Wissenschaften zu Zentren und Motoren für Wirtschafts-und Regionalentwicklung machen“; sie sollen die „Regelhochschulen“ werden, wobei eine Studienplatzerweiterung stattfinden sollte. Ausgründungen sollen stärker gefördert und der regionale Innovations-und Technologietransfer voran getrieben werden. Die „Zwangsfusion“ der BTU Cottbus mit der FH Lausitz hält die CDU für einen Fehler.
Antwort der GRÜNEN
Die GRÜNEN sehen als übergreifendes Ziel die Entwicklung einer Hochschullandschaft, „die den Wissenschaften konkurrenzfähige Möglichkeiten bietet, eng mit der Landesentwicklung und der Überwindung ihrer Strukturprobleme verknüpft ist und sich zugleich kooperativ, arbeitsteilig und produktiv in die gemeinsame Hochschullandschaft der Region Berlin-Brandenburg einpasst.“
Ein Landesforschungsprogramm wird gefordert, das die Themen Klimakrise, Strukturwandel und Nachhaltigkeit besonders berücksichtigt. Nachhaltigkeit als Querschnittsaufgabe der Hochschulen soll im Hochschulgesetz verankert werden. Die Kooperation mit den Hochschulen in Sachsen und Polen soll ausgebaut werden.Konzepte für den öffentlichen Zugang zu Daten und deren Nutzbarkeit im Wissenschaftsbereich werden unterstützt ebenso wie Transparenz-und Zivilklauseln gegen militärische Forschung.
Die derzeitige Anzahl der Studienplätze (ca. 50.000) wird als ausreichend angesehen. Die Gründung einer Medizinischen Hochschule oder Fakultät aus Landesmitteln wird als derzeit nicht möglich eingeschätzt. Gefordert wird die Einführung eines dualen Studienfachs Hebammenkunde. Die Kapazitäten für die Lehramtsausbildung sollen auf Dauer erweitert werden, insbesondere in den Studiengängen Förder-und Inklusionspädagogik. Plädiert wird für die Einführung eines Lehramtsstudiums an der BTU Cottbus, beginnend mit den MINT-Fächern. Insgesamt soll die Lehramtsausbildung praxisnäher gestaltet werden.
Antwort der LINKEN
Die LINKE konstatiert, dass „in den vergangenen 6 Jahren viel im Hochschulbereich passiert (ist), was so 2013 noch nicht absehbar war. Die Debatte um die Beschäftigungsverhältnisse … hat an Dynamik gewonnen, der Transferbegriffwurde um die gesellschaftliche Dimension erweitert, die Rolle der Fachhochschulen hat sich geändert, die Internationalisierung der Hochschulen wird vor dem Hintergrund des Hochschulzugangs von Geflüchteten und der Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse diskutiert.“
Positiv beurteilt wird die Stärkung des Bereiches Lehrerbildung an der Uni Potsdam und die gewachsene Rolle der BTU Cottbus für den Strukturwandel in der Lausitz; „auch die Debatte um eine eigene medizinische Fakultät ist im politischen Raum angekommen“. Ebenso wird die wachsende Bedeutung der Digitalisierung betont: „Besonders spannend sind hier die interdisziplinären Ansätze, die die Digitalisierung in einem sozialwissenschaftlichen Kontext analysieren.“ Alle diese Beispiele begründeten zwingend die Überarbeitung des Hochschulentwicklungsplans.
Antwort der SPD
Die SPD will „die schrittweise Anhebung der Hochschulfinanzen fort(setzen): Die Grundfinanzierung stocken wir in jedem Jahr um 5 Millionen Euro auf. So wollen wir die Studierendenzahlen auf hohem Niveau halten und weiter in die Qualität investieren. Zudem werden wir die Universitäts-und Fachhochschul-standorte auch verkehrstechnisch schnell miteinander vernetzen und direkt an Berlin anbinden.“ Betont wird die Notwendigkeit, „gute soziale Rahmen-bedingungen für Studierende“ zu schaffen. In diesem Sinne will die SPD die Studierendenwerke darin unterstützen, einen „Hochschulsozialpakt“ zu schließen, und sich mit einer Bundesratsinitiative dafür einsetzen.
Einen Schwerpunkt der Stärkung von Wissenschaft und Forschung sieht die SPD in der Lausitz: „Zu nennen sind hier der perspektivische Ausbau der BTU Cottbus-Senftenberg, der Aufbau neuer außeruniversitärer Forschungseinrichtungen und eine Transfereinrichtung in derWestlausitz in Finsterwalde. In der Prignitz werden wir eine Zukunftsakademie Brandenburg aufbauen, die Weiterbildung zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung anbietet. Die Präsenzstelle in Schwedt werden wir durch eine noch engere Verknüpfung mit der dortigen Industrie und der Hochschule in Stettin sowie eine Außenstelle in Prenzlau ausbauen.“
Geplant ist außerdem die „Einrichtung von 25 Digitalisierungslehrstühlen“, um innovative interdisziplinäre Forschung zu ermöglichen. Darüber hinaus soll die Medizinische Hochschule Brandenburg mit ihrem Gesundheitscampus weiter entwickelt werden: „Wir werden die MHB weiterhin finanziell fördern und eine institutionelle Finanzierung oder Beteiligung an der Trägergesellschaft prüfen, um auch im Norden des Landes eine Medizinerausbildung zu erhalten. Im Süden wollen wir mit Hilfe von Geldern aus dem Strukturstärkungsgesetz des Bundes… schrittweise eine Universitätsmedizin aufbauen. Dabei nutzen wir die Ressourcen der BTU Cottbus-Senftenberg und des Carl-Thiem-Klinikums (…) Zudem prüfen wir die Einrichtung eines Pharmaziestudienganges.“
Weiterhin plant die SPD Landarztstipendien und will dafür jährlich 5 Mio. Euro bereit stellen.Auch ein Stipendium für Landlehrerinnen und Landlehrer ist geplant, um junge Fachkräfte frühzeitig an das Land Brandenburg zu binden.Angeknüpft werden soll an die „Transferoffensive Brandenburg“, die das Zusammenwirken von Unternehmen, Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen „mit entsprechenden Förderprogrammen wie dem Brandenburgischen Innovationsgutschein weiter verbessern“ soll. Darüber hinaus sollen die Hochschulen im Rahmen der Bund-Länder-Förderinitiative „Innovative Hochschule“ unterstützt werden. Weitere Vorhaben beziehen sich auf den Ausbau dualer Studiengänge und der Lehrerbildung. Für letztere sind „zeitnah 44 Millionen Euro“ geplant.
2. Qualität von Lehre und Studium
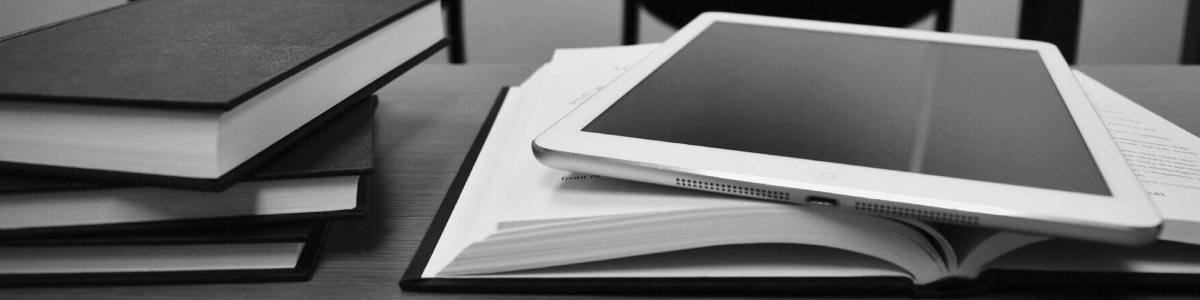
Durch die geplanten Bund-Länder-Vereinbarung „Zukunftsvertrag Studium und Lehre“ haben die Hochschulen finanzielle Planungssicherheit bis 2030. Neben dem Erhalt der Studienplatzkapazität sollen zukünftig die Anstrengungen vornehmlich darauf gerichtet sein, die Lehrqualität und den Studienerfolg zu fördern.
Was sind in Ihrer Vorstellung wichtige Maßnahmen, die das Land und die Hochschulen in Brandenburg ergreifen sollten, um die Qualität von Lehre und Studium zu verbessern?
Was würden Sie tun, um sicherzustellen, dass die zukünftig den Hochschulen zur Verfügung gestellten Finanzmittel auch tatsächlich in Maßnahmen der Verbesserung von Lehr- und Studienqualität fließen?
Antwort der CDU
Die CDU will “insbesondere die Kapazitäten an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften stärken.“ Deren Globalhaushalte „müssen stärker als die der Universitäten steigen.“ Damit einhergehen soll „eine Studienplatzerweiterung für die Fachhochschulen“ und „eine Erhöhung der Curricularwerte“, verbunden mit „mehr Stellen im Mittelbau“. Gefordert wird „eine kontinuierliche Steigerung der Hochschulmittel, die sich an der Entwicklung des Bruttosozialprodukts und an der Entwicklung des Landeshaushaltes orientiert“.
Antwort der GRÜNEN
Die GRÜNEN „ollen die Studienbedingungen durch ein Landesförderprogramm von innovativen Lehr-und Lernformen und verstärkte Investitionen in die Lehre verbessern”. Weiterhin fordern sie: „Die Hochschulen sollen … verbindliche Dauerstellenkonzepte erarbeiten und der ungewollten Teilzeit im akademischen Mittelbau entgegenwirken.“ Die Lehrverpflichtung „muss sich wieder an realistischen Tätigkeitsprofilen orientieren, hierzu wollen wir die Lehrverpflichtungsverordnung ändern.“
„Die Verbesserung der Lehr-und Studienbedingungen kann auch mithilfe eines wirksamen Qualitätssicherungs-und -managementssystems … durch die Hochschulen selbst vorangebracht werden.“ Lehraufträge müssen angemessen vergütet werden, d.h. sie „dürfen nicht billiger sein als Lehre durch angestelltes Personal“.
Antwort der LINKEN
DIE LINKE stellt fest: „Neben der räumlichen und sächlichen Ausstattung braucht Qualität in der Lehre vor allem Zeit. Zeit, um die Lehrveranstaltungen vorzubereiten, aktuelle Forschungsergebnisse einfließen zu lassen, selbst zu forschen, Zeit, um die Studierenden zu betreuen, Prüfungsleistungen abzunehmen und Veranstaltungen nachzubereiten. (…) Damit ist die Lehrdeputatsverordnung des Landes in den öffentlichen Fokus gerückt.
DIE LINKE tritt für die Überarbeitung dieser Verordnung ein, um a) die Trennung zwischen Deputaten mit Lehr-und Forschungsschwerpunkten zu überwinden und b) Deputate festzuschreiben, die den realen Aufwand qualitativ hochwertiger Lehreabbilden.“ Die Verbesserung von Lehre und Studium erfordere Maßnahmen, die „im Mittelverteilungsmodell der Hochschulen eine stärkere Berücksichtigung finden“ als bislang.
Antwort der SPD
Die SPD konstatiert: „Eine unverzichtbare Voraussetzung für eine gute Ausbildung anunseren Hoch-und Fachhochschulen ist eine qualitativ hochwertige Lehre“ und will folgende „Maßnahmen in Erwägung ziehen“, um auf die Qualität von Lehre und Studium Einfluss zu nehmen:
- durch neue Bewertungsverfahren die Lehrverpflichtungsverordnung weiterentwickeln; berücksichtigt werden soll, z.B.: die Anzahl der zu betreuenden Studierenden und der vom Veranstaltungstyp abhängige je unterschiedliche Vorbereitungs-und Prüfungsaufwand.
- durch Änderungen des Kapazitätsrechts die Betreuungsrelationen verbessern,
- durch die Einrichtung von Dauerstellen im akademischen Mittelbau eine größere Kontinuität und Professionalität gewährleisten,
3. Studentische Beschäftigte und Lehrbeauftragte
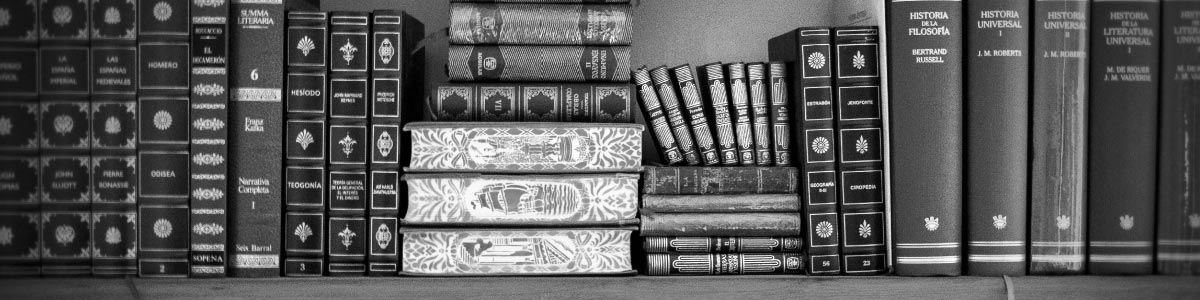
Seit 2018 fallen studentische Beschäftigte unter den Geltungsbereich des Landespersonalvertretungsgesetzes. Gleichwohl bedarf die neue Regelung der Ausgestaltung, um der studentischen Lebensrealität Rechnung zu tragen. So kollidiert im Falle des passiven Wahlrechts die Kürze der studentischen Beschäftigungsverhältnisse mit der wesentlich längeren Wahlperiode des LPersVG, die geforderte Vorbeschäftigungszeit (vgl. LPersVG § 14) kann verhindern, Wählbarkeit zu erlangen.
Welche Vorstellungen zur Ausgestaltung des aktiven und passiven Wahlrechts haben Sie, um studentischen Beschäftigten die Schutz- und Beteiligungsrechte des LPersVG zu sichern?
Das Bundesland Nordrhein-Westfalen hat Lehrbeauftragte ab einem Beschäftigungsumfang von 4 Lehrveranstaltungsstunden in den Geltungsbereich des Landespersonalvertretungsgesetzes aufgenommen.
Wie stehen Sie zu dieser Regelung? Würden Sie die Aufnahme einer ähnlichen Festlegung in das Brandenburgische Landespersonalvertretungsgesetz befürworten?
Studierende müssen neben dem Studium, bedingt durch die unzureichende BAföG-Regelung, zunehmend einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Viele Studierende nutzen die Möglichkeit, sich an ihrer Hochschule um eine Tätigkeit zu bemühen. Allerdings werden ihnen nicht die gleichen Rechte zuerkannt wie Mitarbeiter*innen im Verwaltungs- und Wissenschaftsbereich. So sind sie in allen Bundesländern – mit Ausnahme von Berlin – vom Geltungsbereich der Tarifverträge ausgeschlossen.
Werden Sie sich dafür einsetzen, die Landesregierung zu drängen, mit den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes eine tarifvertragliche Regelung für studentische Beschäftigte auszuhandeln? Was sind Ihre Vorstellungen über den Inhalt der zu verhandelnden Regelungen?
Antwort der CDU
Die CDU will einen „ergebnisoffenen Diskussionsprozess initiieren, um ggf. eine Anpassung der Ausgestaltung des aktiven und passiven Wahlrechts an die besondere Situation studentischer Beschäftigter vornehmen zu können. Verträge mit „studentischen Hilfskräften“ sollten an den Hochschulen „frei ausgehandelt werden“, ohne dass dabei „prekäre Arbeitsverhältnisse entstehen“.
Antwort der GRÜNEN
Die GRÜNEN sehen in der Aufnahme studentischer Beschäftigter ins Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einen überfälligen Schritt, der jetzt durch „Nachjustierungen“ ergänzt werden muss, um die Personalratsarbeit für Studierende attraktiv und mit dem Studium vereinbar zu gestalten. Studentische Beschäftigte sollen nachTarif bezahlt werden. Dabei soll dem Berliner Modell gefolgt und ein eigener Tarifvertrag für diese Personalkategorie realisiert werden. „Absolventinnen mit Masterabschluss sind als akademische Mitarbeiterinnen einzustellen“.
Antwort der LINKEN
Die LINKE bekundet, dass sie ein großes Interesse an der gemeinsamen Diskussion mit Aktivist_innen habe, die Ausgestaltung der Wahlrechtsregelungen zum LPersVG zudiskutieren. „Eine Herausforderung sehen wir vor allem darin, dass die Personalratswahlen an den Hochschulen alle 4 Jahre stattfinden, studentischen Beschäftigten aber nicht auf Grund viel kürzerer Vertragslaufzeiten die Chance verwehrt werden darf, sichin einem solchen Gremium zu engagieren.“
Die Forderung nach einem studentischen Tarifvertrag (StudTV) unterstützt die LINKE, steht aber auch einer Aufnahme der studentischen Beschäftigten in den TV-L offen gegenüber. „Die Anforderungen an einen StudTV sollen sich am Berliner Modell orientieren:
1) Vergütung … in der Höhe von mindestens 14€
2) Rechte und Tarifsteigerungen analog zum TV-L
3) Gewährung von Weihnachts-/ Urlaubsgeld
4) Einhaltung vereinbarter Arbeitszeiten
5) Mindestvertragsdauer von 4 Semestern
6) Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.“
Antwort der SPD
Auch die SPD strebt für studentische Beschäftigte „einen gemeinsamen, tariflich vereinbarten Lohn“ an. Dies sei „ein klares Signal für die Wertschätzung der Arbeit der Studierenden“
4. Investitionsbedarf in Infrastruktur

Ein Ausdruck der anhaltenden strukturellen Unterfinanzierung des Hochschulwesens ist der Investitionsstau bei der Erhaltung der Gebäude und dem Ausbau der digitalen und sozialen Infrastruktur, d.h. z.B. Lehrgebäude, Mensa, Bibliotheken, Wohnheime, u.a.m.
Was wollen Sie in der nächsten Wahlperiode tun, um die Landesregierung zu bewegen, die erforderlichen Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur bereitzustellen?
Antwort der CDU
Die CDU will in der Perspektive „Bauherreneigenschaft und Bauherrenrechte“ auf die Hochschulen übertragen und dies zunächst „in Modellversuchen mit ausgewählten Hochschulen (…) erproben“. Die BLB soll „ertüchtigt“ werden, um Bauvorhaben künftig schneller umsetzen zu können. Außerdem soll ein „Digitalisierungsfonds“ eingerichtet werden.
Antwort der GRÜNEN
Die GRÜNEN fordern, dass Brandenburg bei der Verwendung der Mittelzuwächse aus dem erneuerten Hochschulpakt auch über seine Eigenanteil in die Modernisierung der Hochschulinfrastruktur investieren soll, insbesondere um den Erfordernissen der Digitalisierung zu genügen. Sie können sich „gut vorstellen“, dass die Hochschulen bei Bauvorhaben dauerhaft die Bauherreneigenschaft bekommen.
Antwort der LINKEN
Die LINKE betont besonders die Notwendigkeit einer Erweiterung der Sozialinfrastruktur. „Für uns ist klar, dass diese insbesondere in Golm auf den Prüfstand und das Studentenwerk Potsdam aktiv einbezogen werden muss. Die finanziellen Mittel muss der nächste Landtag bewilligen.“
Antwort der SPD
Die SPD will sicherstellen, „dass Bauen auch bezahlbar bleibt“, und wird in diesem Sinne die Empfehlungen der Baukostensenkungskommission auf ihre Umsetzbarkeit in Brandenburg überprüfen. Sie verweist auf das von ihr gegründete „Bündnis für Wohnen“ und tritt auf Bundesebene für eine Verschärfung der Mietpreisbremse ein.
Welche Vorstellungen haben Sie, wie an den Hochschulstandorten bezahlbarer Wohnraum für Studierende im ausreichendem Umfang geschaffen werden kann?
Antwort der CDU
Die CDU hält die Kapazitäten an Wohnheimplätzen an den meisten Hochschulstandorten für „prinzipiell ausreichend“; „Potsdam ist hier die Ausnahme“.
Antwort der GRÜNEN
Die GRÜNEN wollen sich für mehr Neubau von Studierendenwohnungen und Wohnheimen einsetzen, unter anderem indem sie die Studentenwerke befähigen, selbst Kredite aufzunehmen. Darüber hinaus wollen sie das Wohnungsbauvermögen des Landes Brandenburg und das Landesprogramm für den Sozialen Wohnungsbau, der auch Studierenden offenstehen soll, in puncto Neubau von Mietwohnungen aufstocken.
Antwort der LINKEN
Die LINKE weist auf das zum Ende der Legislatur beschlossene Wohnraumfördergesetz hin, „das es den Studentenwerken ermöglicht, auf die Investitionsmittel des Landes für Sozialen Wohnungsbau zuzugreifen. Nun geht es darum, schnellstmöglich mit den betroffenen Kommunen nach geeigneten Flächen zu suchen, die Studentenwerke in der Realisierung der Bauvorhaben zu unterstützen und damit den Ausbau schnellstmöglich voran zu treiben.“
Antwort der SPD
Die SPD will 2.000 neue Wohnheimplätze schaffen und strebt an jedem Hochschulstandort eine Versorgungsquote von 20 Prozent an. „Wir werden den Studentenwerken die dafür nötigen Finanzmittel zur Verfügung stellen. Die Umsetzung soll anhand eines Förderprogramms für studentischen Wohnraum erfolgen.“
5. Gebühren für Studierende

Im Jahr 2017 wurde die von 2000 bis 2008 im Land Brandenburg erhobene Rückmeldegebühr vom Bundesverfassungsgericht für rechtswidrig erklärt. Die Landesregierung blockierte jedoch die Rückzahlung mit dem Hinweis auf Verjährung des Anspruchs. Im März d.J urteilte das Verwaltungsgericht Potsdam, dass sich die Universität Potsdam, gegen die eine Musterklage geführt wurde, nicht auf Verjährung berufen könne.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass das Land Brandenburg die zu Unrecht erhobenen Gebühren an die Anspruchsberechtigten zurückzahlt?
Zusammenfassung der Antworten
GRÜNE, CDU und LINKE betonen, dass die von 2001 bis 2008 erhobenen sog. Rückmeldegebühren verfassungswidrig waren und zurückgezahlt werden müssen, „wobei das Land als Verantwortlicher die Hochschulen zu entschädigen hat“ (CDU). DIE LINKE will durchsetzen, „dass alle Anspruchsberechtigten die zu Unrecht erhobenen Gebühren zurück erhalten, auch wenn sie nicht geklagt haben.“
Die SPD konstatiert: „Im vorliegenden Fall hat die Universität Potsdam gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Potsdam vom 29. März 2019 über die verfassungswidrige Rückmeldegebühr Berufung eingelegt. Die SPD wird sich nicht in ein laufendes rechtsstaatliches Verfahren einmischen.“
Seit 2008 wird eine Verwaltungsgebühr für Vorgänge wie Immatrikulation, Exmatrikulation, Beurlaubung, Rückmeldung erhoben. Da diese Gebühren unmittelbar mit der Durchführung des Studium verbunden sind, können sie als versteckte Studiengebühren begriffen werden.
Werden Sie sich dafür einsetzen, diese Gebühren abzuschaffen?
Zusammenfassung der Antworten
Bezüglich der seit 2008 erhobenen Verwaltungsgebühren für Vorgänge wie Immatrikulation, Exmatrikulation, Beurlaubung und Rückmeldung differieren die Auffassungen. Während GRÜNE und LINKE diese Gebühren als versteckte Studiengebühren interpretieren und entsprechend abschaffen wollen, sieht die CDU sie als „unmittelbar mit dem tatsächlichen Aufwand verknüpft“ an und will sie beibehalten. Die SPD äußert sich nicht direkt zur Rechtmäßigkeit dieser Gebühren, sondern stellt nur fest: „Seit dem Jahr 2009 wurde der gesetzliche Zweck der Gebührenerhebung explizit erweitert.“
6. Klagerecht für Gleichstellungsbeauftragten

Das Landesgleichstellungsgesetz sieht für Gleichstellungsbeauftragten in Landeseinrichtungen ein Klagerecht vor. Für die Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen ist dies im Hochschulgesetz nicht analog geregelt.
Setzen Sie sich für die Einführung eines Klagerechts für die Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen ein?
Zusammenfassung der Antworten
GRÜNE und LINKE beziehen sich auf das Landesgleichstellungsgesetz und fordern, dass die Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen mit einem Organklagerecht ausgestattet werden, vergleichbar dem der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten.
Die SPD gibt zu Protokoll: „Eine Verschärfung durch die Einführungdes Klagerechtes sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn in der Mehrzahlder Fälle beiderseitige Einigungen durch den Rechtsbehelf des Widerspruches erfolglos geblieben sind.“ Die CDU steht „einer Ausweitung des Klagerechts kritisch gegenüber“.
7. Parlamentarische Initiativen

Welche Initiativen, Projekte oder Gesetzesvorhaben hochschulpolitischer Art wollen Sie in der nächsten Legislaturperiode auf den Weg bringen bzw. umsetzen?
Antwort der CDU
Die CDU strebteine Novelle des BbgHG an. Damit soll die Autonomie der Hochschulen gestärkt und der Hochschulrat aufgewertet werden. Dieser soll z.B. „ein Gutachten über die Situation der Hochschulen im Land mit Empfehlungen zur weiteren Entwicklung“ erarbeiten.Außerdem soll eine „erweiterte Erprobungsklausel“ eingeführt werden, „um den Hochschulen zu ermöglichen, verschiedene Gouvernancestrukturen auszuprobieren“.
Antwort der GRÜNEN
Die GRÜNEN wollen „eine Novellierung des Brandenburgischen Hochschulgesetzes (BbgHG) auf den Weg bringen, das die Autonomie der Hochschulen stärkt, ihnen neue Eigenverantwortlichkeiten gibt, ihre eigenen demokratischen Entscheidungsprozesse fördert und die Abhängigkeit von Ministerien mindert“. Das Land „soll sich auf die Wissenschaftsverwaltung, auf Koordination und Rechtsaufsicht beschränken“. Dadurch beim Land frei gewordene Personalstellen sollen „auf die Hochschulen verteilt werden“. Weiterhin setzen sich die GRÜNEN „für ein gesellschaftspolitisches Mandat der Studierendenschaften ein, wie es zum Beispiel in Berlin gilt“. Sie fordern: „Die Senate und Fakultäts-bzw. Fachbereichsräte müssenviertelparitätisch besetzt werden.
Was künftige Hochschulverträge bzw. Zielvereinbarungen anbelangt, so sollen diese „nicht allein durch die Hochschulleitungen ausgehandelt werden“. Die GRÜNEN wollen außerdem erreichen,dass die Besonderheiten des Wissenschaftsbetriebs im TV-L berücksichtigt werden, zum Beispiel durch eine Befristungszulage. „Um Wissenschaftler*innen eine frühere und familienfreundlichere Karriereperspektive bieten zu können, streben wir die Ausweitung eines verbindlichen Tenure-Track bei Juniorprofessuren an.“ Außerdem sollen sich die Hochschulen Zielquoten für die Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen mit Unterrepräsentanz geben. Die Qualitätsstandards für Chancengleichheit und Familienorientierung sollen verbindlicher ausgestaltet werden; die Frauen-und Geschlechterforschung soll gestärkt werden.
Für Fälle von Diskriminierung und insbesondere Rassismus soll es künftig an den Hochschulen weisungsfreie Beauftragte geben, „die über ausreichend zeitliche und finanzielle Kapazitäten verfügen und die entsprechende Expertise aufweisen“.
Antwort der LINKEN
Die LINKEN nennen für ihre Parlamentsarbeit 5 Schwerpunkte:
1) Codex Gute Arbeit: „Das bisher nur in den Hochschulverträgen benannte Prinzip „Gute Arbeit in der Wissenschaft“ muss mit klaren Zielstellungen für alle Hochschulen untersetzt werden. Gemeinsam mit den Gewerkschaften wollen wir uns für die langfristige Planbarkeit von Karrierewegen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Eindämmung des Befristungssystems an den Hochschulen und den Grundsatz Daueraufgaben für Dauerstellen einsetzen“.
2) Evaluation der Hochschulgesetzesnovelle von 2014: „Insbesondere zu überprüfen sind die tatsächliche Ausweitung der Möglichkeit, in Teilzeit zu studieren, sowie die verpflichtende Einhaltung von Studienverlaufsplänen…“ Als Credo gilt dabei: „Wir wollen, dass alle die Möglichkeit erhalten, ihr Studium erfolgreich zum Abschluss zu bringen, … egal ob Studierende nebenbei erwerbstätig sind, eine Familie gründen, sich um Angehörige kümmern oder sich ehrenamtlich engagieren …“
3) Gesetzliche Mindeststandards bei den Dualen Studiengängen: Dazu gehört, „dass ausbildungsintegrierte Studiengänge, die eine IHK-Prüfung und einen Studienabschluss zum Ziel haben, der Regelfall werden. Praktikumsintegrierte Studiengänge,die Scheinselbstständigkeiten … befördern, lehnen wir ab.“ Außerdem müssen „Vergütungsstandards geregelt“ und muss „der Einfluss der beteiligten Unternehmen auf die Studieninhalte klar begrenzt“ werden.
4) Antirassismusbeauftragte an den Hochschulen: Diese sollen etabliert und ihr Aufgabenspektrum soll, je nach Lage vor Ort, definiert werden.
5) Promotionsrecht als eigenständiges Recht der Fachhochschulen, „nicht nur im Rahmen der Kooperation mit den Universitäten“.
Antwort der SPD
Die SPD konstatiert knapp: „Für die SPD ist das Brandenburgische Hochschulgesetz ein gutes und modernes Gesetz, das viele berechtigte Interessen zusammenbringt. Auch in Zukunft wird die SPD das Hochschulrecht entsprechend aktueller Herausforderungen weiterentwickeln.“
